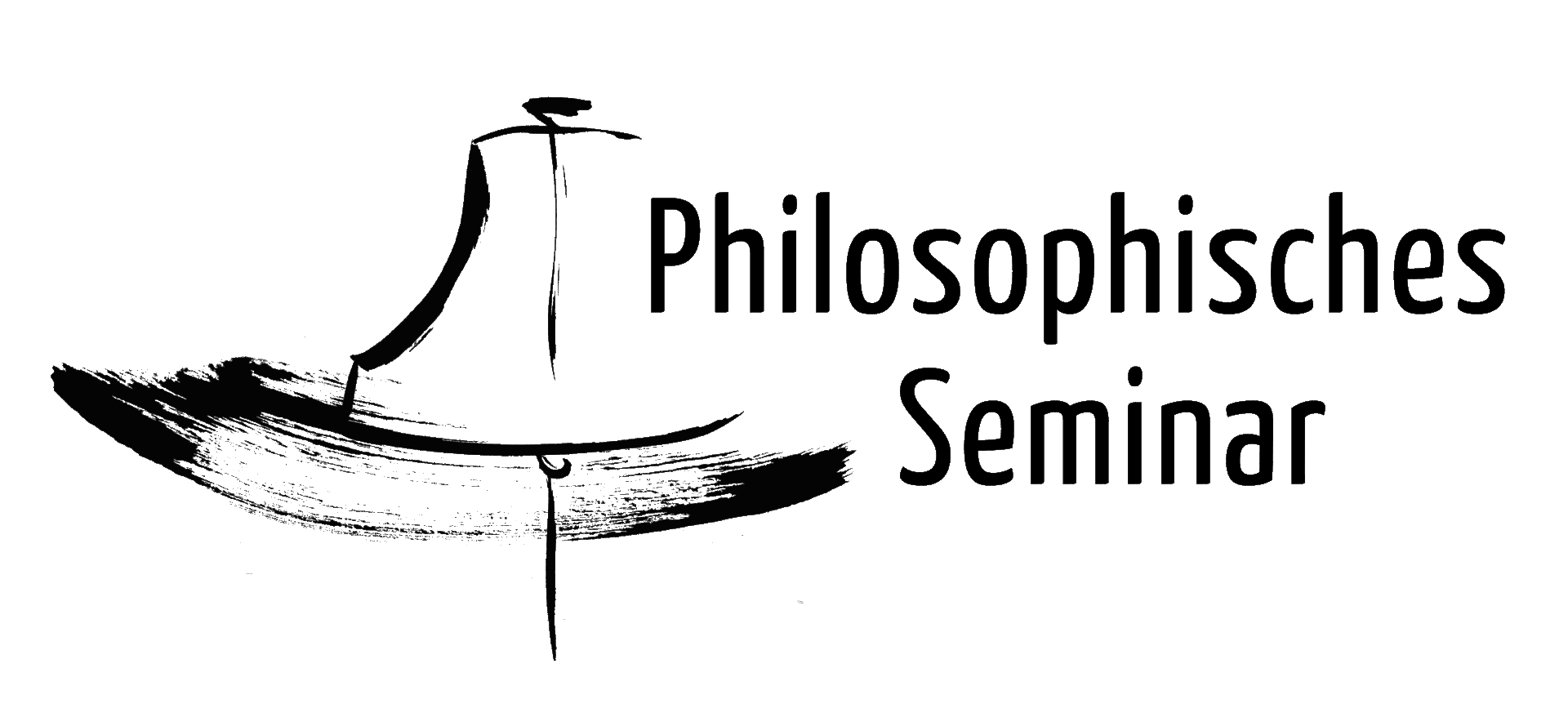Den 20. Dezember [1786]
„Und doch ist das alles mehr Mühe und Sorge als Genuß. Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl, hier was Rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurückgehen, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen müßte, dachte ich nicht. Nun bin ich aber einmal überzeugt und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verleugnen muß, desto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister, der einen Turm aufführen wollte und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch beizeiten gewahr und bricht gern wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, seinen Grundriß sucht er zu erweitern, zu veredeln, sich seines Grundes mehr zu versichern, und freut sich schon im voraus der gewissern Festigkeit des künftigen Baues. Gebe der Himmel, daß bei meiner Rückkehr auch die moralischen Folgen an mir zu fühlen sein möchten, die mir das Leben in einer weitern Welt gebracht hat. Ja, es ist zugleich mit dem Kunstsinn der sittliche, welcher große Erneuerung leidet.“
Goethes Italienreise, die er fluchtartig im September 1786 antritt, um sich aus einer festgefahrenen Lebens- und Arbeitssituation am Hof in Weimar zu retten, ist keine Reise im heutigen Verständnis. Auch wenn so mancher gegenwärtig noch eine sogenannte Bildungsreise zu den italienischen Kunstwerken absolviert – vielleicht sogar von der traditionellen „Bildungsreise“ inspiriert – so muss man, bei genauerem Blick auf die Dokumente, die uns Goethes Reise zugänglich machen, bemerken, dass es für Goethe kein äußerliches Bildungsanliegen war, welches ihn nach Italien trieb. Das obige Zitat aus der Italienischen Reise kann dies verdeutlichen.

Goethes Reisebestreben war ein vollständiger „Umbau“, eine „Verleugnung“ seiner Anlagen bis in die Konstitution hinein. Es war ein Bemerken, dass für seine weitere Entwicklung, die künstlerische und die moralische, das gegebene Fundament (das bekanntermaßen kein so schlechtes war), auf das er sein Leben bisher gebaut hatte, nicht mehr trug. Dass es „abgebrochen“ werden und neu erstehen musste. Dabei äußert er eine große Zuversicht, dass der Neubau gelingen wird. Ein paar Monate später schreibt er:
Neapel, zum 17. März [1787]
„Ich habe viel gesehen und noch mehr gedacht: die Welt eröffnet sich mehr und mehr, auch alles, was ich schon lange weiß, wird mir erst eigen. Welch ein früh wissendes und spät übendes Geschöpf ist doch der Mensch!“
Alles Gewusste, alle Kenntnisse werden einer Revision unterzogen, der Blick dadurch geweitet und das eigene Wesen durchdringt sich unbefangen mit den frischen Eindrücken der Welt. Erst durch den übenden Umgang mit allem, was begegnet, wird das Wissen so umgestaltet, dass es der Entwicklung des ganzen Menschen dienen kann. Wissen alleine, ohne die Erweiterung des Ich zu einem weltfähigen, und dabei immer auch ganz sinnlichen Wesen, bleibt aus Goethes Sicht äußerlich. Ein paar Tage später lesen wir:
Neapel, Dienstag, den 20. März 1787
„Man habe auch tausendmal von einem Gegenstande gehört, das Eigentümliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen…“
Das vorher vielleicht aus Büchern und Kunstreproduktionen, aus Berichten Angeeignete ist aus Goethes Sicht nur eine Vorbereitung, die die Gegenstände nicht zum „Sprechen“, also zur Preisgabe ihres Wesens bringen kann. Eine Behauptung, die uns Heutigen zu denken geben mag, wenn wir sie probeweise zulassen. Alles medial Vermittelte kann kein wahres Erlebnis der Sache geben. Die physische Präsenz ist nötig, um die Erscheinung in ihrer Präsenz wahrnehmen, würdigen und beurteilen zu können.
Wenn wir den Bogen zum ersten Zitat wieder aufnehmen, so deutet sich die Radikalität dieses Ansatzes an: Der existenzielle „Umbau“ der eigenen Konstitution mit und an der Welt geschieht durch reale Weltbegegnung; durch die Bereitschaft, Vorstellungen, Wissen, Vorlieben und Abneigungen hinter sich zu lassen; durch „Verleugnung“ des Gewordenen in uns.
Das mutet möglicherweise alles sehr schwer an und als zu große Herausforderung. Für Goethe aber war es das, was er lebendige Entwicklung nannte, und seine glückliche Natur erlaubte ihm, gerade an der „Auflösung“ und Verwandlung des „alten“ Goethe in einen „wiedergeborenen“ die Freude des Wachsens zu erleben. Er kam als ein neuer anderthalb Jahre später aus Italien zurück. Er hatte seine Künstlersein wieder gefunden und neu bestimmt und konnte sein Weimarer Schicksal anders gestalten. Vielleicht war er auch jetzt erst bereit für die Freundschaft mit Schiller, die 1794 begann, über den Goethe später sagte, er sei jede Woche ein anderer gewesen.