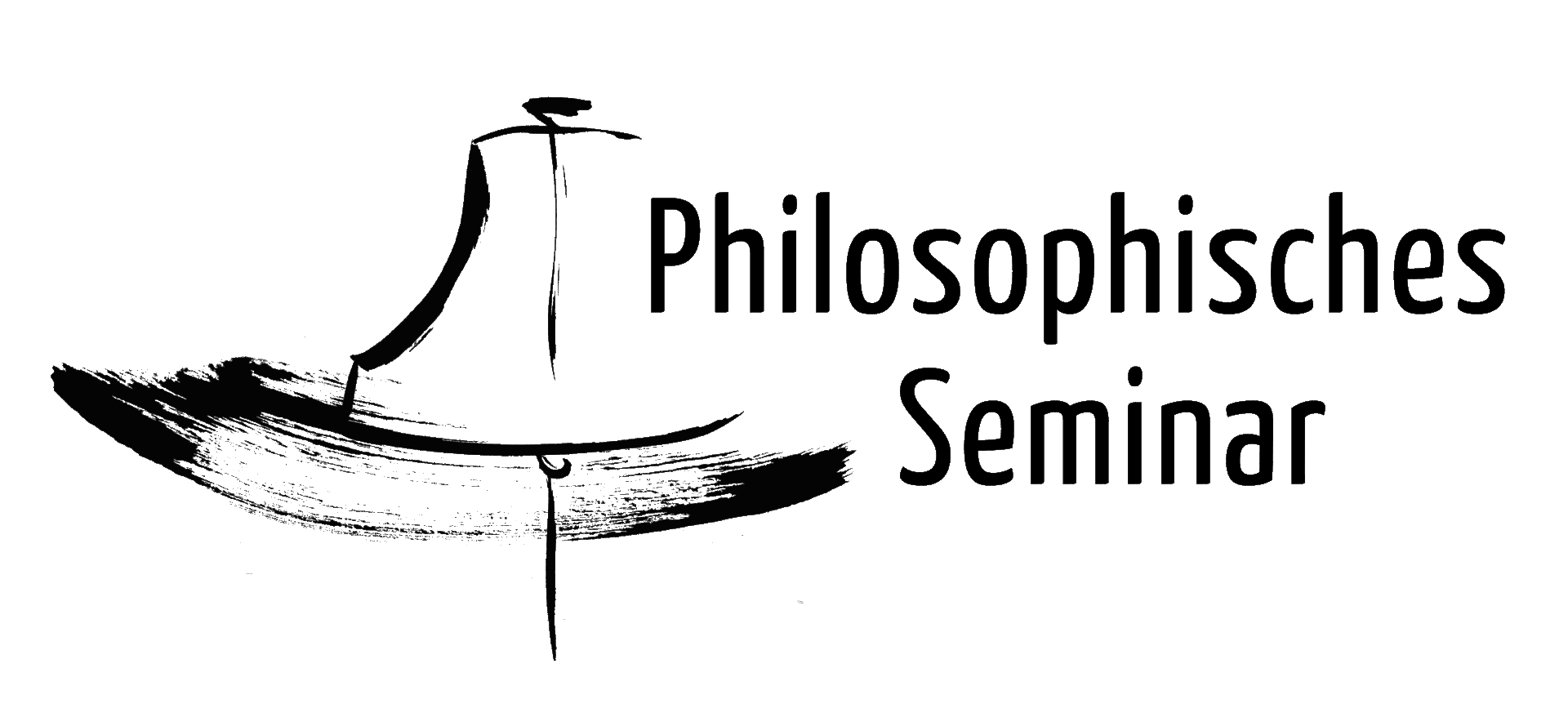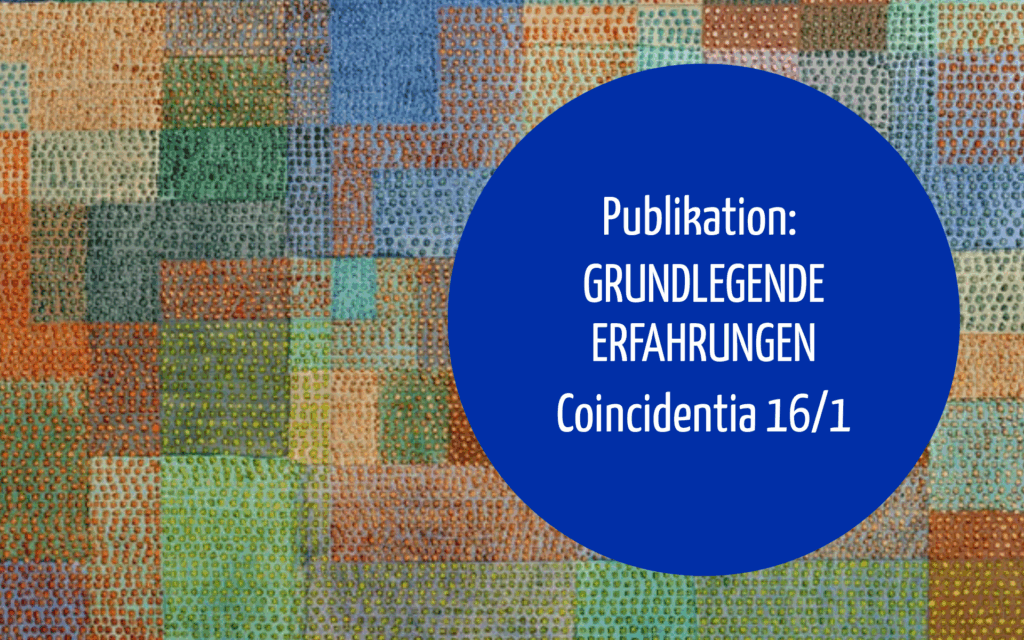
Das neu erschienene Heft 16/1 der Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte blickt auf „Grundlegende Erfahrungen“ des menschlichen Daseins. Die Herausgeber Harald Schwaetzer und Kirstin Zeyer schreiben im Vorwort zu den einzelnen Beiträgen:
Laienphilosophie und Redekunst. Hildegard von Bingen und Nikolaus von Kues von Harald Schwaetzer weist ebenso wie der folgende Beitrag von Wolfgang Christian Schneider mit dem Titel Die revolutionäre, ‚wilde‘ Frömmigkeit und der kognitive Wandel in der Zeit der religiösen Aufbrüche und der Bauernkriege um 1500 auf die im späten Mittelalter und früher Neuzeit waltende differenzierte Vielschichtigkeit des mystischen Erlebens hin; dieses Erleben, so zeigt vor allem Schneider, wird nicht mehr einfach nur rational strukturiert, sondern es ist gerade die Aufgabe der Phantasie, der menschlichen Seele in sich und ihren Erfahrungen Orientierung zu geben.
Jan Kerkmann blickt aus einer anderen Perspektive auf dieselbe Schicht der Seele. In Aus dem Bösen geboren? Ein systematischer Vergleich zwischen Augustinus’ Erbsündenlehre und Schellings Begründung intelligibler Freiheit geht es ihm um ein Bedenken der Frage des Bösen im Spannungsfeld der beiden großen Denker der Spätantike und des Deutschen Idealismus.
Mit Von Wittgenstein lernen: Wittgensteins Kulturkritik und ein Blick auf unsere Zeit umkreist Moritz René Pretzsch dieselbe Tiefe der Seele, die aus dem ihr eigenen Logos stammt, wie Heraklit einmal bemerkt. Wittgensteins Bedenken der Grenzen der Wissenschaft und der Weite des Denkens gelten ihm als bedenkenswerte Reflexionen angesichts einer eher auf einen eingeschränkten Wissenschaftsbegriff einseitig bauenden Gegenwartsgesellschaft.
Wenig überraschend, kann sinnvoll auf diese vier auf ihre Weise zusammengehörenden Beiträge ein Reflexionsschritt folgen, wie ihn Michael Lewin in Philosophie der Orientierung in der Philosophie vornimmt. Die Bewusstwerdung der eigenen Situiertheit sei die Voraussetzung für die Einsicht, dass man sich immer schon orientiert hat. Der Erhellung der grundlegenden Erfahrungen der Modi von Orientierung widmet sich im Anschluss an Stegmaiers Philosophie der Orientierung sein Beitrag.
Die Würde des Mount Everest: Eine philosophische Untersuchung des Bergsteigens, des Massentourismus und der Rechte der Natur von Henrieke Balzer lässt zum Abschluss eine Nachwuchswissenschaftlerin zu Worte kommen. Der Aufsatz ist das Ergebnis einer bei Kirstin Zeyer und Thilo Wesche im Wintersemester 2023/24 an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg verfassten BA-Arbeit. Der Beitrag weist auf die Notwendigkeit einer neuen Naturphilosophie hin, welche die Wesenhaftigkeit der Natur wiederum als grundlegende Erfahrung ins Spiel bringt.
Das im Aschendorff-Verlag erschienene Heft kann in Kürze hier für 24,80 EUR bezogen werden.