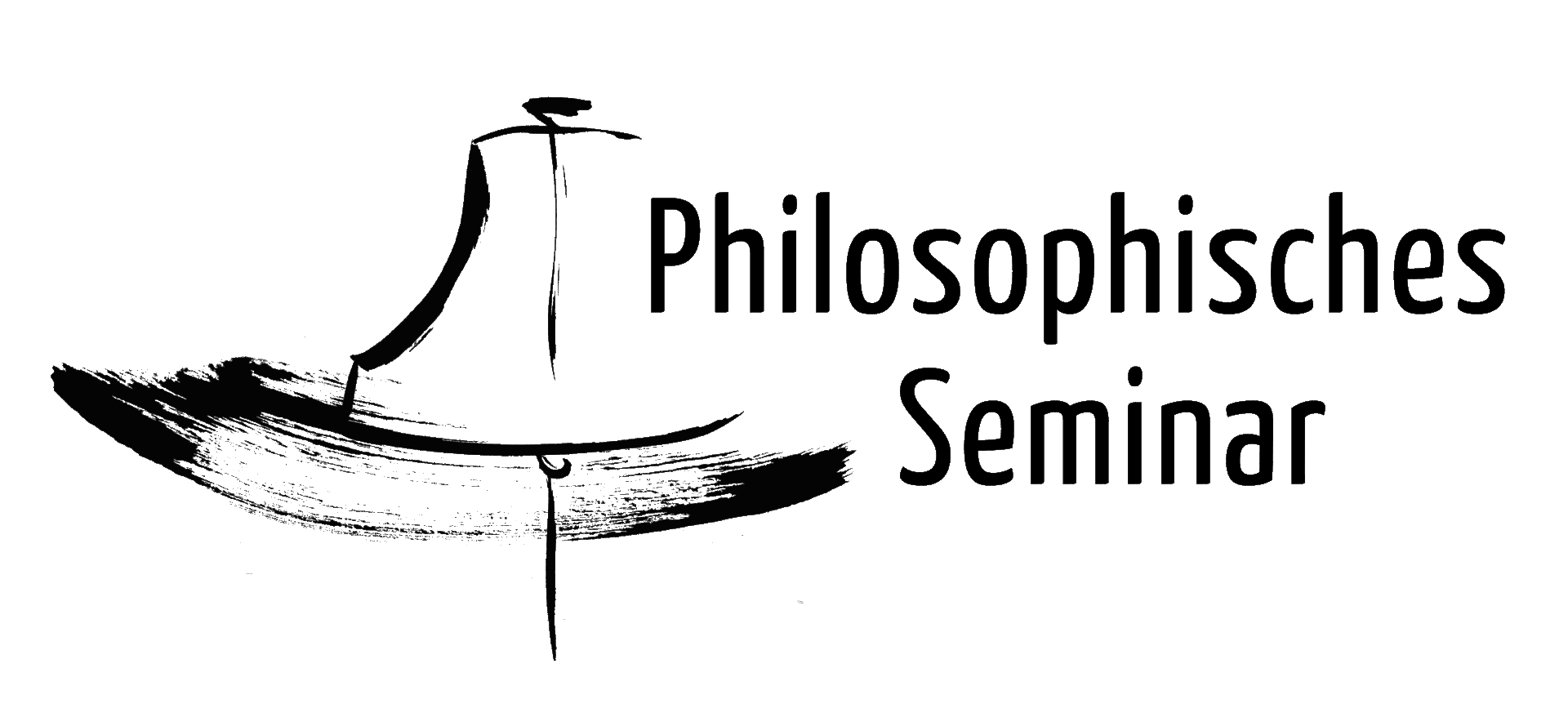„Weder aus sich selbst allein, noch einzig aus den Gegenständen, die ihn umgeben, kann der Mensch erfahren, dass mehr als Maschinengang, dass ein Geist, ein Gott, ist in der Welt, aber wohl in einer lebendigeren, über die Nothdurft erhabnen Beziehung, in der er stehet mit dem was ihn umgiebt.
Und jeder hätte demnach seinen eigenen Gott, in so ferne jeder seine eigene Sphäre hat, in der er wirkt und die er erfährt, und nur in so ferne mehrere Menschen eine gemeinschaftliche Sphäre haben, in der sie menschlich, d.h. über die Nothdurft erhaben wirken und leiden, nur in so ferne haben sie eine gemeinschaftliche Gottheit; und wenn es eine Sphäre giebt, in der zugleich alle Menschen leben, und mit der sie in mehr als nothdürftiger Beziehung sich fühlen, dann, aber auch nur in so ferne, haben sie eine gemeinschaftliche Gottheit.“
Friedrich Hölderlin, Fragment philosophischer Briefe (Auszug, wahrscheinlich 1796)

Bereits der erste Satz dieses unvollendet gebliebenen Entwurfs ist überraschend. Der Mensch könne weder durch Selbsterkenntnis, noch durch Welterkenntnis eine Einsicht darüber erlangen, dass er mehr sei als eine Maschine, dass also etwas Höheres in ihm waltet – sondern allein durch die Beziehung seiner Selbst zur Welt. Und diese Beziehung ist nicht irgendeine, sondern sie ist präzise bestimmt. Sie muss eine „lebendigere“ (als die natürliche) sein und eine, die über die Notdurft erhaben ist.
Der Philosoph und Dichter Hölderlin behauptet somit, dass es für den Menschen Bedingungen gibt, wenn er überhaupt erfahren möchte, dass er kein reiner „Erdenkloß“ ist. Er muss sich über die rein natürlichen Bedürfnisse erheben wollen und er muss dies durch einen inneren Schritt seines Seins und Erkennens über das Tote hinaus in den Bereich des Lebens hinein tun. Die Beziehung zwischen Mensch und Welt – so Hölderlin – ist im Grunde bereits gegeben, er muss sie nicht selbst erzeugen (er „stehet“ in der Beziehung); allerdings bleibt er für sie so lange schlafend, wir würden heute vielleicht sagen unbewusst, bis er sich zur lebendigen Geisterkenntnis erhebt.
Schon dieser Gedanke ist ziemlich komplex. Denn wir müssen eine Erfahrung von Geist denken, die in die vorhandene, tiefer- (oder höher-)liegende Einheit von Mensch und Welt aktiv bildend eingreift, und zwar durch Überwindung eines nur in fertigen, also toten Vorstellungen befangenen Bewusstseins, das zudem ein die Natur übersteigendes ist.
Aber dabei bleibt es nicht, Hölderlin geht weiter: wenn der Mensch auf diese Weise und in seinem Schicksal das ganz individuelle, zunächst nur zu ihm gehörende Göttliche, den „eigenen Gott“ erfahren hat – und nur dann und auf dieser Grundlage – vermag er mit anderen in eine menschliche Gemeinschaft einzutreten. Diese ist nicht durch einen Inhalt bestimmt, sondern durch eine gemeinschaftliche Gottheit!
Der dritte und letzte Schritt liegt nun in der Annahme („wenn es eine Sphäre giebt“), dass es für das allgemein Menschliche eine Sphäre oder ein Schicksal geben kann, wenn diese Voraussetzungen von allen Menschen in Übersteigung naturhafter Gegebenheiten wirklich gelebt und als real anerkannt werden. Erst wenn auch dies erfüllt ist und nur, wenn sie auch aktuell vollzogen wird, gibt es aus des Dichters Sicht das Recht, von einer Gottheit zu sprechen, die für alle Menschen da ist und alle umfasst: sie hängt somit von der individuellen geistigen Aktivität ab, die diese Sphäre erst schafft und sie entsteht und vergeht im Akt des Vollzuges.
Hölderlin entwickelt hier einen erstaunlich modernen Gottesbegriff, der 1. nicht abstrakt und damit schemenhaft bleibt, weil er stufenweise aufsteigende, das heißt in ihrem Wirkbereich immer weiter reichende, konkrete hierarchische Wesen denkt; und der 2. die Offenbarung des Göttlichen ganz vom Menschen abhängend macht: Menschlichkeit und Gemeinschaftsbildung als Beziehungsstiftung durch Erkenntnis und als Resultat individueller geistiger Entwicklung in aufsteigende höhere Sphären hinein: das ist es, was Hölderlin vor mehr als 225 Jahren vorzuschlagen hatte. In seiner Dichtung hat er uns das Leben in Sprache und Bild dargebracht und so eine über die Jahrhunderte hinreichende Hand ausgestreckt, die wir auch heute noch ergreifen können.